9 Rollen/Disziplinen, die ein Scopemanager beherrschen muss.
Management Summary
Das Problem: Scope-Management ist keine einzelne Rolle – es ist ein Netz aus Erwartungen, Verantwortlichkeiten und politischen Machtachsen. Genau das macht es so gefährlich: Alle reden mit, aber keiner steuert. In Krisenprojekten ist das der größte Blindspot.
Scope-Management wird in SAP-Großprojekten oft wie eine Randnotiz behandelt – delegiert an Projektleitung, Requirements Engineers oder PMO. Doch wer den Scope nicht führt, wird geführt: von Termindruck, Stakeholdern und politischen Kompromissen.
Die Realität: Der größte Irrtum? Zu glauben, Scope-Management sei eine Rolle. In Wahrheit umfasst es mindestens 9 Teilverantwortungen, die im Projekt oft unverbunden nebeneinander existieren – und so Krisen vorprogrammieren.
Die Lösung: Strategisches Scope-Management mit klarer Gesamtverantwortung, KI-gestützter Scope-Erhebung und dem Mut zur bewussten Unvollständigkeit.
Der ROI: Projekte mit professionellem Scope-Management reduzieren Overruns um durchschnittlich 60 % und verkürzen die Time-to-Market um bis zu 40 %.
Handlungsempfehlung: Scope-Management muss Chefsache werden. Ohne Mandat kein Erfolg. Investieren Sie in echte Scope-Kompetenz – nicht in Excel-Akrobatik.
Strategisches Scope-Management braucht ein Mandat, einen klaren Orchestrator – und moderne Werkzeuge wie KI, um komplexe Abhängigkeiten transparent zu machen.
Liebe CIOs, liebe Projektverantwortliche,
lassen Sie uns mit einer provokanten These beginnen: Sie haben keinen Scope-Manager. Sie haben einen Scope-Verwalter. Und genau darin liegt das Drama unzähliger SAP-Großprojekte, die wie moderne Titanics majestätisch vom Stapel laufen – nur um am ersten Eisberg namens Scope-Creep zu zerbrechen.
1️⃣ Scope ist das ungeliebte Kind im Projekt
- Zu technisch für den Vorstand
- Zu politisch für die IT
- Zu operativ für Strategieberatung
- Zu diffus für das PMO
Ergebnis: Niemand führt den Scope – alle zerren daran.
Scope-Management wird damit zur Folge von Einzelmeinungen: Die lauteste gewinnt. Oder die späteste Eskalation.
2️⃣ Die Rollen – und ihr fataler Beitrag zum Nicht-Management
Auf den ersten Blick kümmern sich viele ums Scope-Thema. Auf den zweiten: Keiner fühlt sich gesamtverantwortlich.
Scope-Management in SAP-Großprojekten bedeutet:
➡️ Den funktionalen, organisatorischen und technischen Projektumfang aktiv zu steuern – und nicht nur zu dokumentieren.
➡️ Abgrenzungen zu definieren, Nutzwert zu maximieren und politische Realität zu managen.
➡️ Parallelisierung zu ermöglichen und Abbruchpfade einzubauen.
Dabei reicht es nicht, den Scope „irgendwo“ festzuhalten. Er muss laufend justiert, verantwortet und kommuniziert werden – über 9 beteiligte Rollen hinweg:

Fazit: ➡️ Scope wird zerlegt, verteilt, entpolitisiert.➡️ Es fehlt die übergreifende Führungsrolle mit Entscheidungsgewalt. Dieses organisatorische „Niemand ist zuständig“ ist in Wahrheit der größte Scope-Risiko-Faktor.
3️⃣ Der Make-or-Buy-Test: Der Lackmustest für echtes Scope-Management
Hier kommt der ultimative Test: Kann Ihr Scope-Manager Make-or-Buy-Entscheidungen treffen? Wenn nicht, haben Sie keinen Scope-Manager, sondern einen Excel-Künstler mit fancy Titel.
Ein echter Scope-Manager muss sagen können: 🛑 „Diese Funktionalität bauen wir nicht – wir kaufen sie zu.“ ✂️ Oder noch mutiger: „Diese Anforderung streichen wir komplett.“ Wenn Ihr vermeintlicher Scope-Manager bei solchen Aussagen nervös zu zucken beginnt und nach der Geschäftsführung ruft, dann ist er Teil des Problems, nicht der Lösung.
Wer dazu nicht befugt ist, ist nicht verantwortlich – sondern Alibi.
4️⃣ Das Arche-Paradox – oder: Wenn Vollständigkeit zum Verhängnis wird
Stellen Sie sich vor, Noah hätte moderne Projektmanager gehabt. Das Briefing wäre gewesen: „Alle Tiere sollen mit.“ Punkt. Keine Priorisierung, keine Phasen, keine Ausstiegsoptionen. Ergebnis: Eine Arche so groß wie ein Kontinent – die niemals fertig wird.
Gutes Scope-Management bedeutet: Den Scope so zu strukturieren, dass man ihn später leicht verringern kann.
In SAP-Projekten heißt das konkret:
- Nicht alphabetisch nach Modulen vorgehen (CO, FI, MM, SD…)
- Sondern nach Geschäftswert und Abhängigkeiten
- Features in Ausbaustufen denken
- Evolutionspfade schaffen statt Revolutionen planen
5️⃣ KI im Scope-Management: Kein Hype, sondern Hilfe
KI-basierte Scope-Erhebung ermöglicht heute:
- 🔍 Automatische Anforderungsanalyse aus bestehenden Systemen
- 🔗 Intelligente Abhängigkeitserkennung zwischen Geschäftsprozessen
- 📈 Predictive Scope-Risiko-Assessment basierend auf historischen Projektdaten
- 🔄 Real-time Scope-Impact-Analyse bei Änderungsanfragen
Das ist keine Science Fiction – das ist 2025. Und das ist der Unterschied zwischen Scope-Verwaltung und strategischem Scope-Management.
6️⃣ Warum scheitern 90% aller Scope-Manager?
Die unbequeme Wahrheit? Scope-Management ist ein politisches Minenfeld. Ein guter Scope-Manager hat keine Freunde. Er ist derjenige, der „Nein“ sagt, wenn alle „Ja“ hören wollen. Er ist der Spielverderber auf der Wunschkonzerttour der Fachabteilungen.
Die häufigsten Fehlstellungen für Scope-Manager:
- 🚫 Fehlende Befugnis: Sie dürfen entscheiden, haben aber keine Macht
- 🧩 Politische Naivität: Sie glauben, Sachargumente würden reichen
- 🛠️ Mangelnde fachliche Tiefe: Sie verstehen nicht, was sie verwalten
- 📉 Fehlende KPIs: Niemand misst ihren Erfolg
- 😰 Überforderung: Sie sollen alles können, bekommen aber keine Unterstützung
7️⃣ Die 5 Prinzipien erfolgreichen Scope-Managements
- Optionen für Abbruch schaffen – Jeder Scope-Teil muss für sich geschäftsfähig sein.
- Frühes Feedback einbauen – MVPs, Walkthroughs, Prototypen statt Endabnahme.
- Evolutionspfade schaffen – Kein Big Bang. Lieber rollierend, validiert und lernfähig.
- Änderungsfähigkeit ermöglichen – Scope ist ein Regelkreis, kein Lastenheft.
- Paralleles Arbeiten sichern – Conway’s Law ernst nehmen & Architektur entkoppeln.
🎯 Fazit: Mut zur Lücke
Scope-Management ist die Kunst, bewusst unvollständig zu sein. Es ist die Fähigkeit, 80% des Wertes mit 50% des Aufwands zu liefern. Es ist der Mut zu sagen: „Das brauchen wir nicht. Noch nicht. Vielleicht nie.“
In einer Welt, in der jedes SAP-Projekt „alles können“ soll, ist der Scope-Manager der Einzige, der noch fragt: „Aber müssen wir wirklich alles können?“
Die Antwort ist fast immer: Nein.
Und genau darin liegt die Kunst – und der Geschäftswert – echten Scope-Managements.
Sie stecken in einer SAP-Projektkrise?
Manchmal ist die beste Lösung, nicht alles lösen zu wollen. Sprechen Sie mit operativen Krisenmanagern, die dort Verantwortung übernehmen, wo andere nur beraten.
🧭 Ihr nächster Schritt
Wenn der Scope in Ihrem Projekt:
- verteilt ist,
- politisch blockiert wird,
- oder niemand klar verantwortlich ist,
dann brauchen Sie keine neue Methode, sondern einen Orchestrator mit Entscheidungsmacht.
Christoph Lefkes , Daniel Goldberg und Matthias Berth

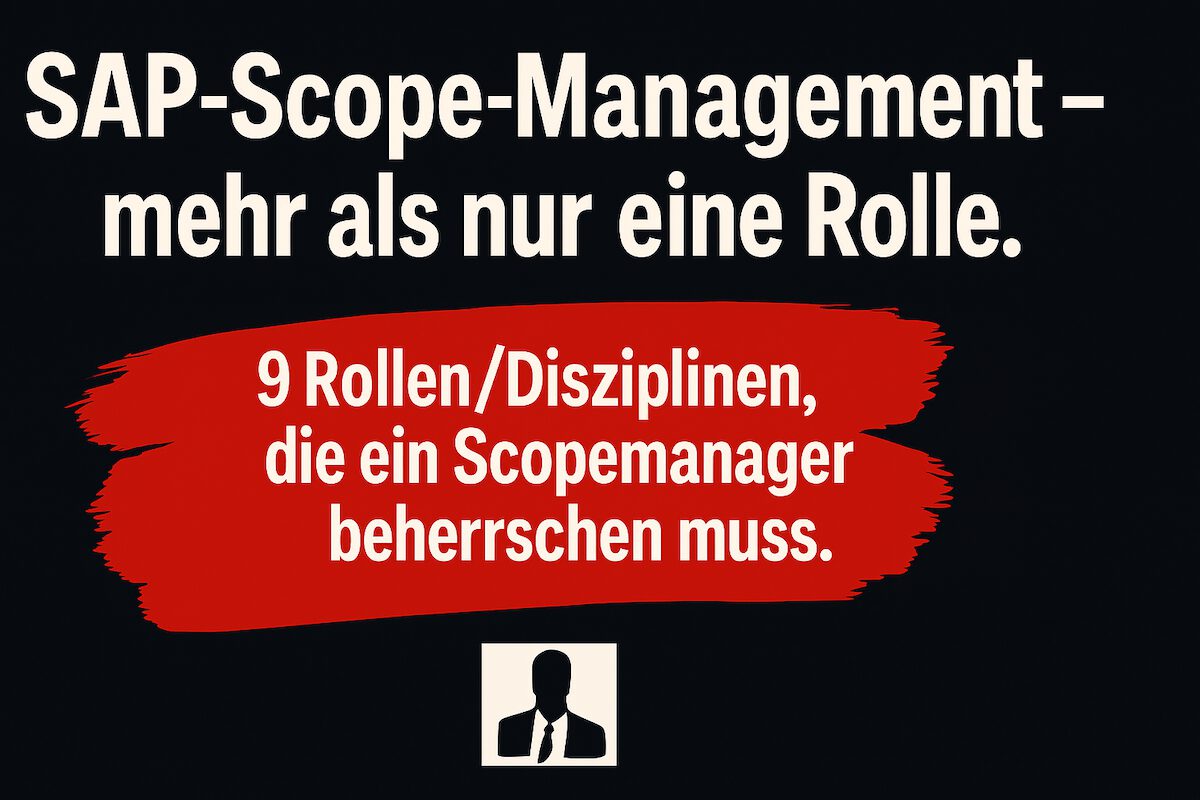
Schreibe einen Kommentar